
Ev. Kirchengemeinde Baukau

Predigt Sacharja 9,9-10 (29.11.2020)
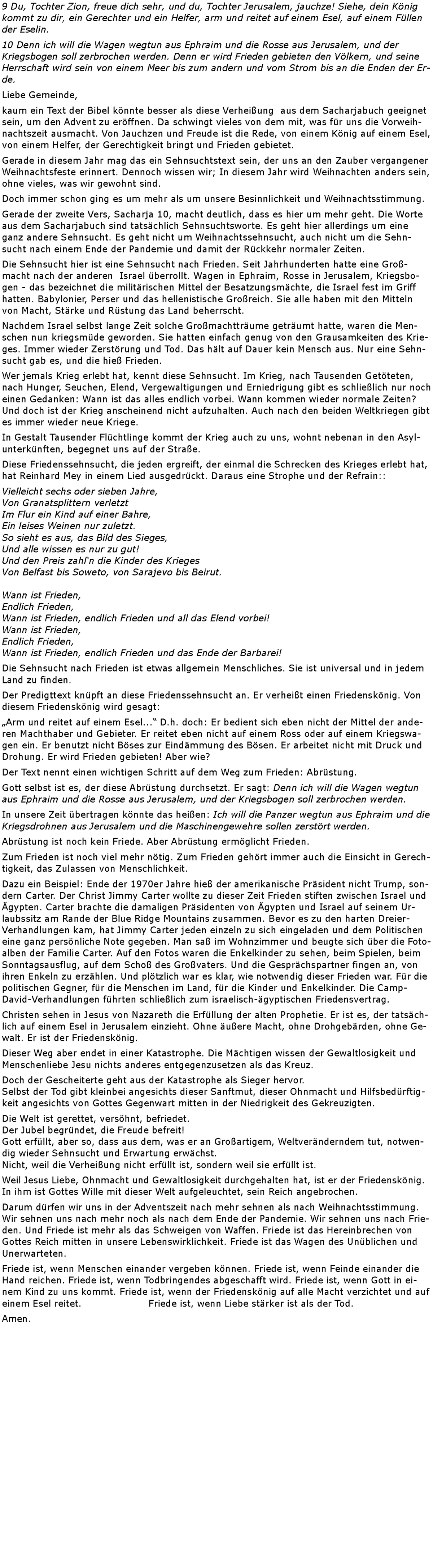
Predigt Jes 1,10-17 (Buß- und Bettag, 18.11.2020)
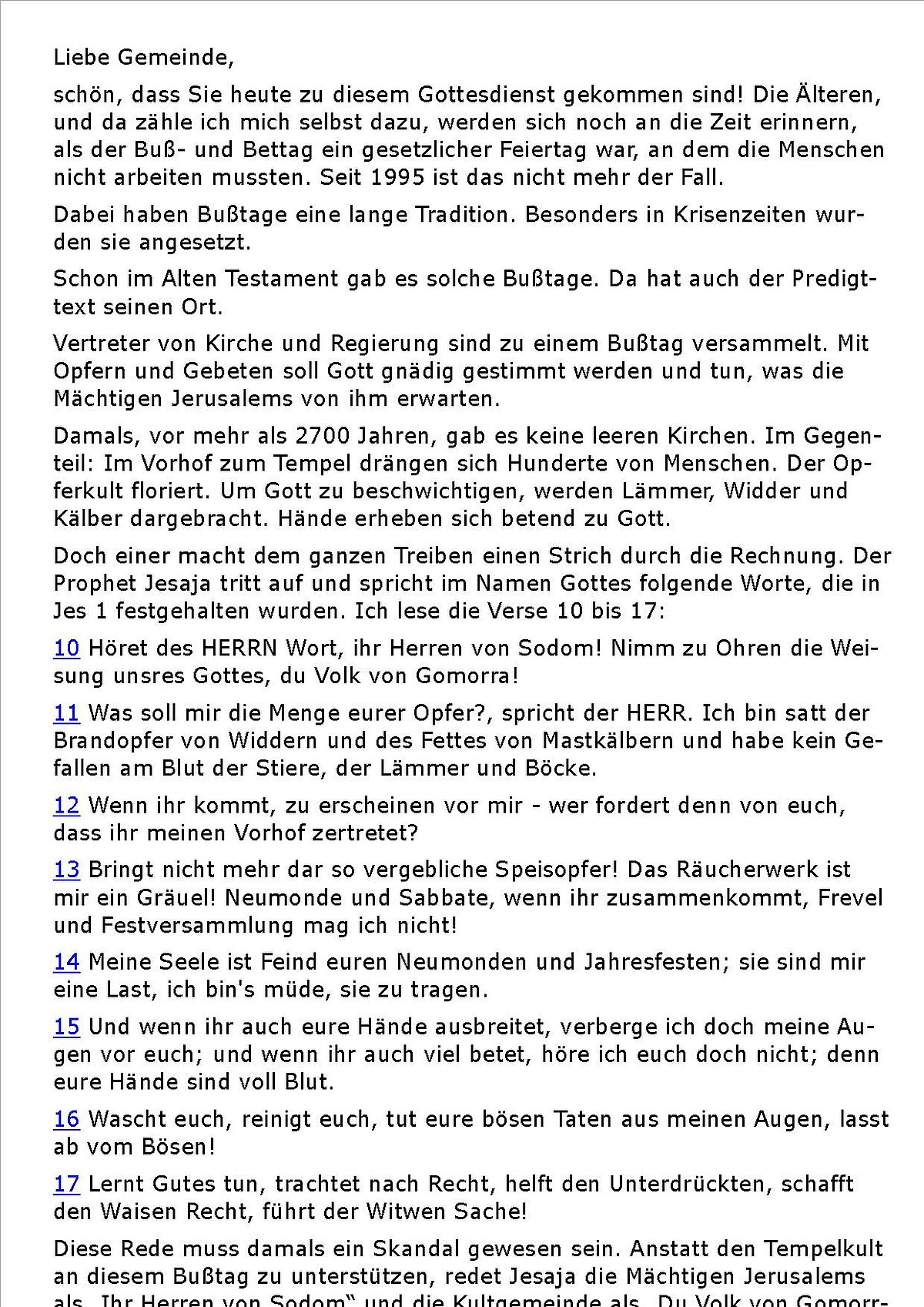
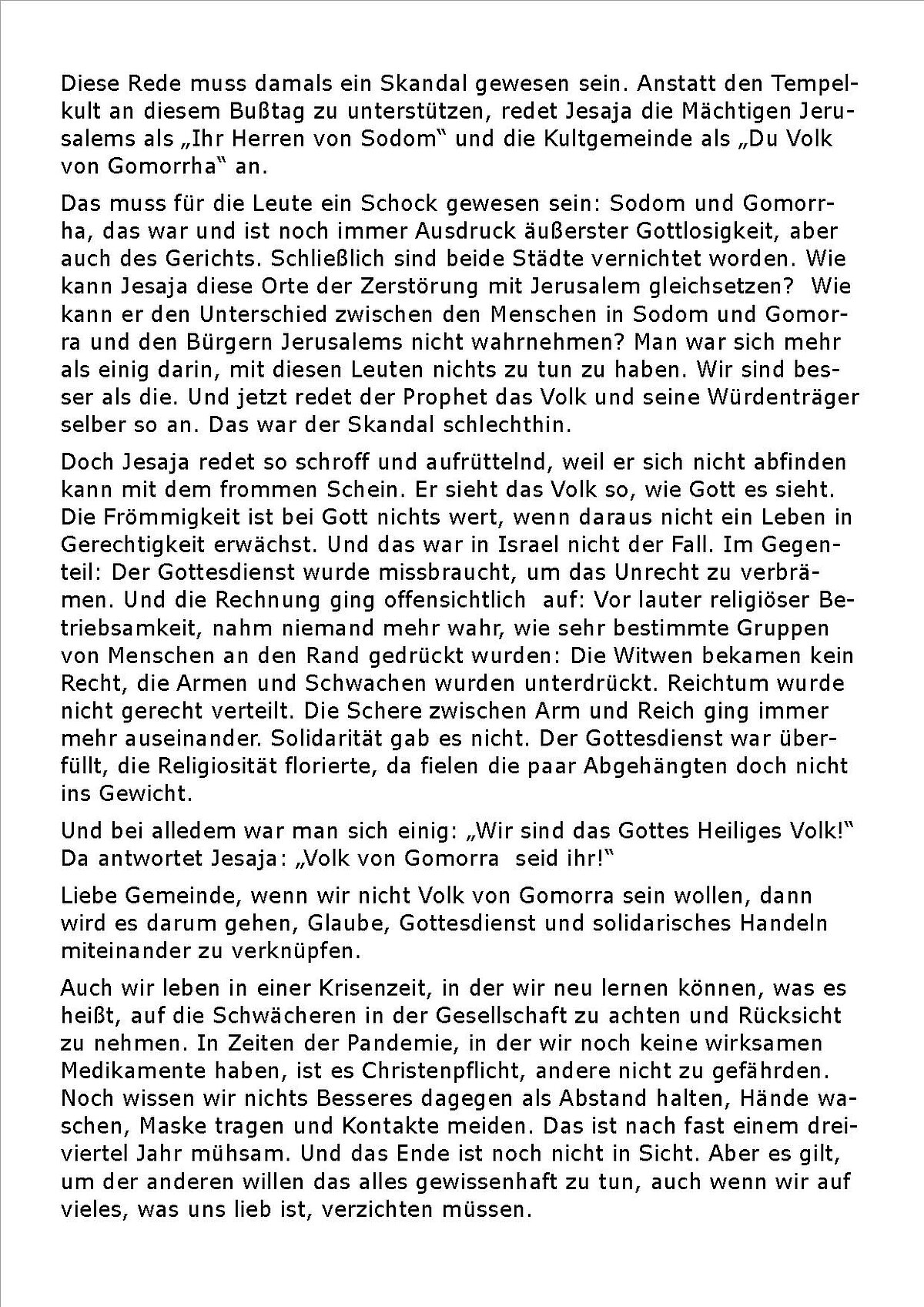

Predigt zum Reformationstag 2020 (01.11.2020)

Predigt Jeremia 1 (09.08.2020)
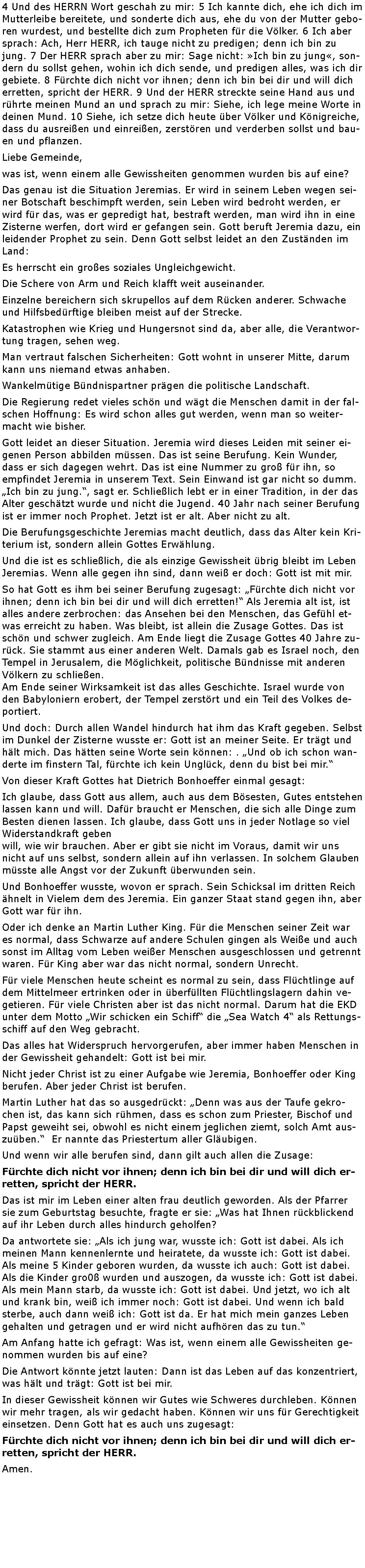
Predigt über Hebr. 13,1-3 (19.7.2020)


Predigt über Lk 5 (12.07.2020)
1 Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, zu hören das Wort Gottes, da stand er am See Genezareth. 2 Und er sah zwei Boote am Ufer liegen; die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. 3 Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und lehrte die Menge vom Boot aus. 4 Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus! 5 Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen; aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. 6 Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. 7 Und sie winkten ihren Gefährten, die im andern Boot waren, sie sollten kommen und ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. 8 Da Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir! Ich bin ein sündiger Mensch. 9 Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die mit ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten, 10 ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht! Von nun an wirst du Menschen fangen. 11 Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach.
Liebe Gemeinde,
versetzen Sie sich einmal in die Situation galiläischer Fischer vor rund 2000 Jahren: Immer wieder der gleiche Ablauf: Bei Einbruch der Dunkelheit heißt es ins Boot einsteigen. Dann wird auf den See hinausgefahren. De Netze werden ausgeworfen und später wieder eingeholt. Das ist harte Arbeit. Das verlangt Kraft. In der Morgendämmerung wird wieder angelegt. Dann müssen die Fische verkauft werden. Die Netze werden gereinigt, getrocknet und geflickt. Das Boot muss in Schuss gehalten werden. Der Tag verrinnt bis zur nächsten Nachtschicht. Dann heißt es, wieder Hinausfahren auf den See.
Reich wird man davon nicht. Zu hoch sind die Steuern, die man als Fischer bezahlen muss. Man kann gerade so davon leben, es sei denn.. Es sei denn es passierte so etwas wie heute. Die Netze blieben leer. Die Arbeit ist die gleiche. Es bleibt schwere Arbeit. Auch die leeren Netze müssen anschließend wieder gereinigt, getrocknet und geflickt werden. Die Steuern müssen trotzdem bezahlt werden. Nach einem langen Arbeitstag bleibt nichts, womit Petrus seine Familie hätte ernähren können. Er fühlt sich wie ein Versager. Nichts hat er den Menschen, die er liebt, zu bieten. Wie steht er da? Petrus, der Versager.
Doch dann geschieht das Ungewöhnliche. Auf einmal ist er da. Erst steht er am Ufer. Dann steigt er in sein Boot. Ausgerechnet in das Boot des Petrus. Es ist Jesus. Kein Fischer, eher ein Menschenfischer. Ein Bote Gottes, aber einer mit einer unvergleichlichen Autorität. Es ist, als wäre Gott selbst an Bord gekommen.
Jesus kommt an Bord des leeren Fischerbootes ohne Fische. Spätestens jetzt müsste Jesus sehen, dass Petrus versagt hat, dass die Arbeit der Nacht umsonst gewesen ist. Wie steht Petrus jetzt vor Jesus: Wohl kaum anders als ein Versager. Aber Jesus verspottet ihn nicht. Mit keinem Wort geht er auf die bittere Niederlage des Petrus ein. Stattdessen bittet er ihn um etwas. Er bittet ihn vom Ufer wegzufahren, damit Jesus von dort aus zu den Menschen sprechen kann, die ihn bis dahin bedrängt hatten. Petrus tut ihm den Gefallen und Jesus redet zu den Menschen von seinem himmlischen Vater.
Danach will Jesus noch etwas von ihm. Diesmal spricht er keine Bitte aus, sondern befiehlt: „Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus!“ Petrus weiß, dass das jeglicher Vernunft entbehrt. Am Tag, im prallen Sonnenlicht, kommen keine Fische an die Oberfläche. Dazu ist es viel zu warm. So tief können sie ihre Netze gar nicht auswerfen, dass sie im kalten Wasser etwas fangen würden. Aber Petrus spürt: Jetzt geht es nicht um Fachwissen, sondern um Zutrauen. „Habe ich das Zutrauen,“ fragt sich Petrus, „dass der, der so authentisch und liebevoll und glaubhaft von Gott geredet hat, dass der mich jetzt nicht noch mehr bloßstellen will, dass am Ende alle rufen, die am Ufer stehen: „Petrus, der Versager, fängt keine Fische mehr!“ Im Gegenteil: Petrus spürt: Dieser Jesus will mir Gutes, nichts als Gutes. Petrus vertraut Jesus. Und so fahren sie noch einmal hinaus und werfen die Netze aus.
Da geschieht das Wunder: Als sie die Netze einholen, sind sie bis zum Bersten gefüllt. Das Gefühl, Gott selbst wäre mit an Bord, verdichtet sich. Petrus fällt vor Jesus nieder. Dieser reagiert jedoch mit einem neuen Auftrag: „Fürchte dich nicht! Von nun an wirst du Menschen fangen.“ Als sie wieder am Ufer sind, lässt Petrus alles liegen und stehen und folgt Jesus.
Liebe Gemeinde, diese Geschichte ist so bekannt, dass fast jeder sie kennt. Es ist eine Geschichte, die mitten im Leben spielt, mitten in der harten Realität des Alltags. Der ausgebliebene Fischfang trifft Petrus fast so hart wie das ausgebliebene Einkommen zu Coronazeiten. Die Verpflichtungen gehen weiter, doch wovon sollen sie bezahlt werden? Kein Hilfspaket, keine solidarische Unterstützung greift. Wer in dem, was er eigentlich können sollte, versagt, dessen Welt droht zu zerbrechen. Ein Fischer, der nicht fischen kann, ein Ehemann, der seine Familie nicht ernähren kann. Petrus der Versager.
Doch alle diese Selbstzweifel sind von einem Augenblick auf den anderen wie weggeblasen. Denn plötzlich ist Gott da. Ungebeten und unverdient. Er ist da in dem, der so authentisch, voller Liebe und echt von Gott redet. Gott ist da in Jesus von Nazareth. Größer als das Wunder der vollen Netze ist das Wunder, dass Jesus dem Versager Petrus etwas zutraut. Jesus bittet ihn um einen Gefallen. Damit wertet er ihn auf, macht ihn unverzichtbar. So unverzichtbar, dass er ihn in seine Nachfolge ruft. Und Petrus lässt alles liegen und stehen und folgt ihm.
Liebe Gemeinde, was für eine Geschichte! Die Gegenwart Jesu verwandelt alles. Gerade noch am Tiefpunkt seines Lebens, gefangen in Resignation und Selbstzweifel, erfährt Petrus eine unerwartete Wertschätzung und ein unbegreifliches Zutrauen durch Jesus. Dieses Zutrauen braucht Petrus jetzt mehr als alles andere. Weil Jesus ihm vertraut, kann sein Leben gelingen.
Wie sehr wir das Vertrauen eines anderen brauchen, macht folgende Geschichte deutlich:
Der Opa feiert einen runden Geburtstag. Anlässlich dieses besonderen Tages, wurden neue Sektkelche angeschafft. Die Familie und Freunde sind an diesem Ehrentag eingeladen. Auch der dreijährige Enkel ist dabei. Die Feier beginnt mit einem Sektumtrunk. Dazu müssen die neuen Sektkelche aus dem Barfach geholt und auf den Tisch gestellt werden.
Da macht der Opa etwas ganz Ungewöhnliches: Er ruft den Enkel zum Barfach und gibt ihm einen neuen Sektkelch in die Hand. Der Opa bittet den Enkel, die teuren Kelche nach und nach zu den Gästen auf den Tisch zu stellen. Das Gespräch der Gäste stockt umgehend. Ein Raunen geht durch das Wohnzimmer. Proteste werden geäußert: „Opa, das kannst du doch nicht machen. Man gibt doch so etwas nicht in die Hände eines Dreijährigen. Stell dir nur vor, er stolpert und fällt in das Glas. Opa, nimm ihm die Kelche weg!“ Doch Opa und Enkel machen weiter. Der Dreijährige ist sich seiner Verantwortung bewusst. Er will nicht nur zeigen, was er kann, er will vor allem dem Vertrauen, das in ihn gesetzt wurde, gerecht werden. Ein Kelch nach dem anderen erreicht sicher den Tisch.
Liebe Gemeinde, ich möchte Ihnen einen Satz sagen, der helfen kann, wenn (Selbst)zweifel an einem nagen: „Wenn Du nicht an Gott glauben kannst, Gott glaubt an dich!“ Wie schnell sagen wir doch: „Mir fehlen die Fähigkeiten. Was kann ich schon so richtig gut? Bin ich nicht schon zu alt?“ Das mag sogar zutreffen, aber Gott lässt sich dadurch nicht beeindrucken. Der Satz gilt: „Wenn Du nicht an Gott glauben kannst, Gott glaubt an dich!“ Diese Tatsche lässt Petrus Jesus folgen. Er will dem vertrauen, der ein so großes Vertrauen in ihn gesetzt hat.
Die vollen Netze sind ein Bild für Gottes Möglichkeiten. Sie stehen nicht für die Vergangenheit als Fischer, sondern für seine Zukunft als Menschenfischer. Die Zukunft der Kirche heute scheint dunkel zu sein. Immer mehr Menschen scheinen die Kirche nicht zu brauchen. Doch die vollen Netze sind auch für uns ein Zeichen der Hoffnung. Die Zeit der Kirche ist noch nicht vorbei. Die Menschen brauchen einen Gott, der sie wertschätzt und ihnen Vertrauen schenkt. Sein Evangelium soll zu allen kommen, die Leben und Zukunft suchen. Gott kann und will gerade uns dazu gebrauchen. Amen.
Predigt Röm 12,17-21 (05.07.2020)
17 Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. 18 Ist's möglich, soviel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. 19 Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes; denn es steht geschrieben (5. Mose 32,35): »Die Rache ist mein; ich will vergelten, spricht der Herr.« 20 Vielmehr, »wenn deinen Feind hungert, so gib ihm zu essen; dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln« (Sprüche 25,21-22). 21 Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.
Liebe Gemeinde,
als Kind habe ich in den 70er Jahren jede Woche eine Folge „Dick und Doof“ im Fernsehen geguckt. Ich fand es total lustig, wenn Stan Laurel und Oliver Hardy ihre Konflikte auslebten. Das Prinzip aller Filme war gleich: Meist begann es harmlos mit einem oft versehentlichen Anrempeln. Der andere reagierte darauf mit einem absichtlichen Zurückschlagen. Die Spirale von Gewalt und Gegengewalt war eröffnet. Meist endete es damit, dass am Ende alles in Schutt und Asche lag. Ich fand das als Kind einfach nur lustig und habe mir darüber keine weiteren Gedanken gemacht.
Doch wenn man genauer hinsieht, dann funktionieren auch andere Filmgenres nach dem Dick-und-Doof-Prinzip, nur dass es hier nicht mehr lustig ist. Von James Bond bis zu aktuellen Blockbustern finden wir immer wieder das gleiche Prinzip: Das Böse wird mit noch mehr Bosheit überwunden. Noch mehr Gewalt besiegt die ursprüngliche Gewalt.
Dieses Prinzip spiegelt sich auch in der Politik. Auf den Terroranschlag auf das World Trade Center, bei dem ca. 3000 Menschen getötet wurden, folgte der Afghanistankrieg mit allein 43.000 getöteten Zivilisten. Der Terroranschlag war schrecklich, aber die Antwort darauf war noch schrecklicher.
Der amerikanische Theologe Walter Wink nennt das dahinter stehende Prinzip den „Mythos von der erlösenden Kraft der Gewalt“. Zu diesem Prinzip zählt die Überzeugung, dass Gewalt rettet, Krieg Frieden bringt und Macht Recht schafft. Die Tragik aber ist, das dieses Prinzip nicht funktioniert, weder bei Dick und Doof, noch in den Kriegen, die seit den 90er Jahren im Nahen Osten geführt wurden. So konnte die damalige EKD-Ratsvorsitzende am 1. Januar 2010 in ihrer Neujahrspredigt sagen: „Nichts ist gut in Afghanistan.“ Und heute, 10 Jahre später, stimmt dieser Satz immer noch. Trotz aller Gewalt, trotz aller Waffen herrscht noch immer kein tragfähiger Frieden.
Der heutige Predigttext ist die biblische Alternative zum Glauben an die erlösende Kraft der Gewalt. Paulus, und mit ihm die ganze Urchristenheit, war überzeugt davon, dass der Weg der Gewaltlosigkeit der Weg zum Frieden ist.
Rache ist gerade nicht süß, sondern bitter. Sie vergiftet das Herz dessen, der sich rächt. Rache befreit nicht, sondern liegt als Last schwer auf dem Menschen, der sie ausübt.
Das ist für Paulus mehr als nur Lebenserfahrung. Seine Haltung ist rückbezogen auf Jesus Christus selbst. Denn Christus hat diese Gewaltspirale durch seinen Tod am Kreuz durchbrochen. Er stirbt unschuldig und seine gelebte Gewaltfreiheit fordert seine Nachfolger auf zu einem gewaltfreien Widerstand.
Gewaltfreiheit meint nicht Duckmäusertum, das sich alles gefallen lässt. So hat beispielsweise Martin Luther King die Rassentrennung in den USA nicht einfach hingenommen, sondern mit gewaltfreiem Widerstand zu überwinden versucht. Das ist sicher nicht leicht, aber alternativlos. Alle Alternativen, die auf Gewalt beruhen, machen die Not nur größer. Paulus denkt ganz im Sinne der Bergpredigt, wenn er sagt: »Wenn deinen Feind hungert, so gib ihm zu essen; dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln« Wie Jesus weitet er die Nächstenliebe auf die Liebe zum Feind aus. Indem der Feind durch Gutes beschämt wird, wird er als Feind überwunden.
Dazu möchte ich eine extremes Beispiel von Feindesliebe erzählen. Der Christ Erino Dapozzo berichtet:
„Während der NS-Regierung wurde ich 1943 von einem deutschen Militärgericht zum Tode verurteilt. Da ich verheiratet war und vier Kinder hatte, wurde das Urteil in eine „mildere Strafe“ umgewandelt. Man brachte mich in ein deutsches Konzentrationslager. 9 Monate nach meiner Einlieferung ins Lager wog in nur noch 90 Pfund. Mein Körper war mit Wunden bedeckt, dazu hatte man mir den rechten Arm gebrochen und mich ohne ärztliche Behandlung gelassen.
Am Weihnachtsabend 1943 saß ich mit anderen Männern im Lager zusammen, als mich der Kommandant rufen ließ. Ich erschien mit entblößtem Oberkörper und barfuss. Er dagegen saß vor einer reich gedeckten, festlichen Tafel. Ich musste stehend zusehen, wie er eine Stunde lang ass. Und in dieser Stunde setzte er mir schwer zu, weil ich Christ war. Eine Ordonanz brachte Kaffee und ein Päckchen Kekse herein. Der Lagerkommandant begann, auch diese zu essen. Dann wandte er sich an mich: „Deine Frau ist eine gute Köchin, Dapozzo.“ Ich verstand nicht, was er damit meinte. Dann erklärte er mir: „Seit sieben Monaten schickt dir deine Frau Pakete mit kleinen Kuchen. Ich habe sie mit großem Vergnügen aufgegessen!“
Als der Krieg vorüber und ich auf freiem Fuß war, hielt ich Ausschau nach diesem Lagerkommandanten. Die meisten einstmals befehlenden Offiziere waren erschossen worden; ihm jedoch war es gelungen zu entkommen und unterzutauchen. Zehn Jahre lang suchte ich ihn vergebens. Doch schließlich fand ich ihn, und eines Tages ging ich ihn besuchen. Er erkannte mich nicht mehr wieder. Daraufhin sagte ich ihm: „ Ich bin Nummer 17531. Erinnern sie sich an Weihnachten 1943?“ Nun erinnerte er sich an all das Grauen.
Er und seine Frau bekamen plötzlich furchtbare Angst. Zitternd fragte er: “Sie sind gekommen, um sich zu rächen?“ „Ja“, antwortete ich und öffnete ein Paket, dass ich mitgebracht hatte.
Ein großer Kuchen kam zum Vorschein. Ich bat seine Frau, Kaffee zu kochen. Dann haben wir zusammen Kaffee getrunken und Kuchen gegessen. Der Mann sah mich völlig verwirrt an. Er konnte nicht verstehen, warum ich so handelte. Schließlich begann er zu weinen und bat mich um Verzeihung.“
Dieses extreme Beispiel macht deutlich, wie Gutes selbst das Böseste überwinden kann. Wenn wir versuchen, dieses extreme Beispiel auf unser Leben herunter zu brechen, haben wir keine Garantie, dass es so funktioniert. Aber wir haben das gute Gefühl, das Richtige zu tun. Wir haben die Spirale von Gewalt und Gegengewalt durchbrochen.
Was für individuellen Ebene gilt, gilt nicht weniger in der Verantwortung für ganze Völker. Dazu noch eine Geschichte:
Von einem alten chinesischen Kaiser wird berichtet, dass er seine Feinde besiegen und sie alle vernichten wollte. Später sah man ihn mit seinen Feinden speisen und scherzen. „Wolltest du nicht die Feinde vernichten?“ fragte man ihn. „Ich habe sie vernichtet“, gab er zur Antwort, „denn ich machte sie zu meinen Freunden!“
So hat es der Kaiser geschafft, das Böse mit Gutem zu überwinden, indem er seine Feinde gespeist hat! Amen!
Predigt Mt 11,25-30 (20.06.2020)
25 Zu der Zeit fing Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies Weisen und Klugen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. 26 Ja, Vater; denn so hat es dir wohlgefallen. 27 Alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand kennt den Sohn als nur der Vater; und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. 28 Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. 29 Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir; denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. 30 Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht.
Liebe Gemeinde,
in diesen Zeiten gibt es wohl kaum einen Menschen, der ohne Sorgen wäre. Ganze Berufsgruppen kämpfen um ihre Existenz. Andere riskieren ihre Gesundheit, um anderen zu helfen. Wenn überhaupt, ist ein Dankeschön der Lohn dafür. Ältere und Kranke sind noch mehr isoliert als sie es sonst schon waren. Gestern erzählte mir eine Frau am Telefon, dass sie aus Vorsicht, sich zu infizieren, das Haus seit März gar nicht mehr verlassen habe. Und der Blick in andere Länder offenbart noch Schlimmeres. In Brasilien, wo Corona besonders heftig wütet, werden die Menschen in Massengräbern beigesetzt. Die Welt im Ausnahmezustand. Wer gestern noch auf der Gewinnerseite des Lebens stand, der kann heute schon zu den Verlierern gehören.
Auf diesem Hintergrund bekommen die Worte Jesu eine ungeheure Aktualität. Er ist schon da, wo viele heute unfreiwillig hinkommen: bei den Mühseligen und Beladenen, bei denen, die nicht anerkannt werden, bei den Unmündigen und Gescheiterten. Die Unterschicht war die größte gesellschaftliche Gruppe zur Zeit des NT. Pächter, Arbeitslose, Tagelöhner, Sklaven und Bettler gehörten dazu. Jede Wirtschaftskrise und jede schlechte Ernte war eine reale Bedrohung des Lebens und förderte gleichzeitig den Abstieg aus der Mittelschicht in die Unterschicht. Einmal dort angekommen, war es kaum möglich wieder aufzusteigen.
Jesus knüpft mit seiner Botschaft nicht bei der Oberschicht an. Er versucht nicht, deren Zustimmung zu gewinnen, sondern er wendet sich von Anfang an denen zu, die in der Gesellschaft ganz unten stehen. Sie waren es, die sich um ihn drängten und ihm zuhörten. Zu Tausenden scharten sie sich um Jesus, weil sie spürten, dass er die Menschen weder an einer sozialen, noch an einer moralischen Leiter maß. Für ihn waren sie alle Kinder Abrahams, Gottes wertvolle Geschöpfe, denen er genau das zusprach, was andere ihnen verweigerten: Anerkennung und Würde. Auf diesem Hintergrund wundert es nicht, wenn Jesus in unserem Predigttext ausruft: „Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies Weisen und Klugen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart.“
Die scheinbar Unmündigen sind es, die das Evangelium hören und annehmen. Bei Gott sind sie nicht Ersatz für die ursprünglich Gerufenen, sondern sie sind von Anfang an gemeint. Mit ihnen hält Jesus Tischgemein-schaften, wendet sich ihnen helfend und wertschätzend zu, kehrt in ihre Häuser ein und gibt ihnen das Gefühl, dass auch sie zu Gott gehören dürfen. Es entsteht schon zu Jesu Lebzeiten eine Gemeinschaft, die so bunt ist wie der Regenbogen.
Während der Gott des Tempels und der Synagoge ein strafender und urteilender Gott war, erleben die dort Verurteilten in der Gemeinschaft Jesu Gott als den bedingungslos Liebenden. Im Reden und Handeln Jesu ist der Gott Israels präsent wie in keinem anderen sonst. Jesus drückt das so aus: „Niemand kennt den Vater als nur der Sohn.“ In seinem Sohn Jesus Christus ist der ganze Gott gegenwärtig. Wendet sich Jesus einem Menschen zu, dann wendet sich ihm Gott zu. Und Jesus wendet sich allen zu. Den Hohen und den Niedrigen. Den Reichen und den Armen, den Frommen und den Sündern. Aber nur die Niedrigen sind es, die sich über diese Zuwendung freuen können. Nur die Armen und Sünder begreifen seine Zuwendung als Zuwendung Gottes. Die anderen beschimpfen ihn als Fresser und Säufer, sehen Jesus als vom Teufel besessen. Nicht nur im Internetzeitalter, sondern auch damals schon waren die Menschen zu einem regelrechten Shitstorm fähig.
Doch Jesus hat sich davon nicht aufhalten lassen. Kompromisslos bleibt seine Zuwendung zu denen, die von Tempel und Synagoge ausgeschlossen waren. Jesus ist kompromisslos gnädig. Jesus ist kompromisslos vergebend. Diese Haltung hat er schließlich mit dem Leben bezahlt. Spätestens jetzt wurde er selbst zu einem Gescheiterten, einem scheinbar von Gott Verstoßenen. Doch in seiner Auferweckung erweist sich Gott als Gott der Gescheiterten und Verstoßenen, der Unreinen und Sünder.
In der Coronakrise haben wir die Chance zu lernen, dass unser Status in der Gesellschaft keinen Bestand hat. Wer gestern noch auf der Gewinnerseite des Lebens stand, der kann heute schon zu den Verlierern gehören. Gerade jetzt kann uns aufgehen: Wir sind nicht das, was wir in unserem Leben geleistet haben. Wir sind nicht unser Können und Leisten. Wir sind auch nicht unser religiöses Können und Leisten. Wir sind nicht weniger, sondern mehr. Wir sind von Gott bedingungslos angenommen und geliebt. Wir sind, was Gott uns durch Jesus Christus beimisst: geliebt, geachtet und wertvoll. Auch wenn alles andere wegbricht, das bleibt.
Darum kann Jesus sagen:
„Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. 29 Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir; denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. 30 Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht.“
Wer zu Jesus kommt, der verabschiedet sich gleichzeitig von allen Versuchen, Gott durch das zu beeindrucken, was wir im Leben erreicht und geleistet haben. Wer zu Jesus kommt, der taucht ein in eine radikal andere Welt. In dieser Welt begegnet uns Gottes Sanftmut und Liebe. Wer zu Jesus kommt, für den lösen sich nicht automatisch alle Sorgen und Nöte. Wer zu Jesus kommt, findet Frieden mitten in aller Not des Lebens. Der darf tun, wozu das Lied einlädt:
Lege deine Sorgen nieder, leg sie ab in meiner Hand. Du brauchst mir nichts zu erklären, denn ich hab dich längst erkannt. Lege sie nieder in meine Hand. Komm, leg' sie nieder, lass sie los in meine Hand. Lege sie nieder, lass' einfach los. Lass' alles fall'n, nichts ist für deinen Gott zu groß.
Amen.
Predigt Lk 10,25-37 (28.06.2020)
25 Und siehe, da stand ein Gesetzeslehrer auf, versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? 26 Er aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? 27 Er antwortete und sprach: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt, und deinen Nächsten wie dich selbst« (5. Mose 6,5; 3. Mose 19,18). 28 Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet; tu das, so wirst du leben. 29 Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster? 30 Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber; die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halb tot liegen. 31 Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog; und als er ihn sah, ging er vorüber. 32 Desgleichen auch ein Levit: Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. 33 Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin; und als er ihn sah, jammerte es ihn; 34 und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. 35 Am nächsten Tag zog er zwei Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn; und wenn du mehr ausgibst, will ich dir's bezahlen, wenn ich wiederkomme. 36 Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden dem, der unter die Räuber gefallen war? 37 Er sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tu desgleichen!
Liebe Gemeinde,
neulich stand ich bei Aldi an der Kasse. Die Schlange war lang, denn vorne ging es nicht weiter. Eine ältere Frau mit Rollator war sichtlich überfordert. ‚Wie sollte sie sich gleichzeitig am Rollator festhalten, bezahlen und ihre Einkäufe einpacken? Dazu hätte sie mindestens vier Hände gebraucht. Direkt hinter ihr stand ein türkisches Ehepaar in der immer länger werdenden Schlange. Da ergriff der Mann die Initiative. „Wenn Sie erlauben, dann packe ich für Sie die Sachen ein.“ Sorgfältig legt er ein Teil nach dem anderen in die Einkaufstasche, begleitet von den Schimpfen der alten Dame, dass er das aber nicht ordentlich mache. Der Mann aber blieb die ganze Zeit über ruhig, freundlich und gelassen. Als er fertig war, bekam er kein „Dankeschön“, sondern nur den Hinweis, dass sie das aber alles viel sorgfältiger gemacht hätte.
Mit dieser Alltagsbeobachtung sind wir schon mitten drin in der Geschichte vom barmherzigen Samariter. Hier wie da ist es gerade ein Mensch, der im gesellschaftlichen Ranking für Nächstenliebe nicht ganz oben steht. Im Gleichnis ist es ein Samariter, in der Alltagsgeschichte ist es ein Türke. Wir hören das Wort Samariter heute ganz von dem Gleichnis Jesu her. Da ist ein Samariter eben ein Mensch, der hilft. Für die Hörer Jesu war das anders. Da war das Wort Samariter ausschließlich negativ besetzt. Jeder fromme Jude hätte damals gesagt: „Samaritaner“ – die sind gewalttätig: überfallen Pilger aus Galiläa. „Samaritaner“ – das sind abtrünnige Häretiker: Die haben sich auf ihrem Berg Garizim einen Konkurrenztempel gebaut. „Samaritaner“ – in deren Adern fließt Ausländerblut: Die haben sich mit den assyrischen Soldaten vermischt, die bei ihnen angesiedelt wurden. Kurz gesagt, ein Samaritaner galt als gottlos, häretisch und gewalttätig. Ähnlich negativ besetzt sind in unserer Gesellschaft Personengruppen wie „Ausländer“, Flüchtlinge“ oder eben „Türken“. Schnell finden wir dafür Begriffe wie „Kriminelle“, „Bedrohung“, „Terroristen“.
Priester und Levit aber waren beide Vorbildgestalten der Frömmigkeit und der Gesetzestreue. Sie standen für die Befolgung der Gebote und damit auch für Nächstenliebe und Barmherzigkeit.
Um die Anstößigkeit des Gleichnisses besser zu verstehen, muss man es heute vielleicht so erzählen:
Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber; die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halb tot liegen. 31 Es traf sich aber, dass ein katholischer Priester dieselbe Straße hinabzog; und als er ihn sah, ging er vorüber. 32 Desgleichen auch ein evangelischer Pfarrer: Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. 33 Ein Türke aber, der auf der Reise war, kam dahin; und als er ihn sah, jammerte es ihn; 34 und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn.
Jesus will mit seiner Geschichte nicht weniger, als Grenzen sprengen. Er sprengt die engen Grenzen von Gut und Böse, von Schwarz und Weiß. Er sprengt die in den Köpfen fest zementierte Grenze, dass das Gute immer von Repräsentanten der eigenen Volks- und Glaubensgemeinschaft ausgehen muss.
Jesus kämpft gegen das tief verankerte Vorurteil, dass ein Nichtjude zur Nächstenliebe gar nicht in der Lage sei. Darum ist es in seiner Geschichte ein Samaritaner, der die Not des Überfallenen nicht sieht, um dann darüber hinwegzusehen. Er sieht die Not und lässt sich davon berühren. In der Lutherübersetzung heißt es: „Es jammerte ihn!“ Als einziger ist er in der Lage, mit dem in Not Geratenen mitzufühlen. Aus diesem Mitgefühl erwächst dann die Hilfe. Das Mitgefühl wird zur Nächstenliebe.
Eine besondere Aktualisierung hat Papst Franziskus dem Gleichnis gegeben, als er 2013 die Flüchtlingsinsel Lampedusa besuchte. In seiner damaligen Bußpredigt sagt der Papst:
„...wir sind in die heuchlerische Haltung des Priesters und des Leviten geraten, von der Jesus im Gleichnis vom barmherzigen Samariter sprach: Wir sehen den halbtoten Bruder am Straßenrand, vielleicht denken wir „Der Arme“ und gehen auf unserem Weg weiter; es ist nicht unsere Aufgabe; und damit beruhigen wir uns selbst und fühlen uns in Ordnung. Die Wohlstandskultur, die uns dazu bringt, an uns selbst zu denken, macht uns unempfindlich gegen die Schreie der anderen; sie lässt uns in Seifenblasen leben, die schön, aber nichts sind, die eine Illusion des Nichtigen, des Flüchtigen sind, die zur Gleichgültigkeit gegenüber den anderen führen, ja zur Globalisierung der Gleichgültigkeit. In dieser Welt der Globalisierung sind wir in die Globalisierung der Gleichgültigkeit geraten. Wir haben uns an das Leiden des anderen gewöhnt, es betrifft uns nicht, es interessiert uns nicht, es geht uns nichts an!“ (Papst Franziskus, Lampedusa, 8. Juli 2013)
Leider sind diese eindringlichen Worte des Papstes auch 7 Jahre später noch immer aktuell. An der Globalisierung der Gleichgültigkeit hat sich nichts geändert. Seitdem sind an die 20000 Menschen bei ihrer Flucht über das Mittelmeer gestorben. Hinzu kommen überfüllte Flüchtlingslager in Griechenland, in denen sich 10000de Geflüchtete drängen. Mitten in Europa liegen Menschen wie der Überfallene in ihrem Blut. Das christliche Europa sieht diese Not und geht weiter. Schlimmer noch: Die Rettungsorganisationen, die sich die Rettung der Ertrinkenden zum Ziel gesetzt haben, werden kriminalisiert, Helfer als Gutmenschen diffamiert.
Dabei ist es doch so einfach: Wer die Not sieht, der müsste sie nur an sich heranlassen. Wer sein Herz für die Not des halbtoten Bruders am Straßenrand öffnet, der wird auch bereit sein zu helfen.
Das ist vor einem Jahr beim Kirchentag in Dortmund geschehen. Aus der Idee „Wir schicken ein Schiff“ ist inzwischen Tat geworden. Die EKD hat ein Schiff erworben, das im Juli in See stechen soll, um Menschen auf dem Mittelmeer zu retten. Das ist zwar nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber es ist ein wesentliche Beitrag zu dem Programm des Gleichnisses: Sehen, (Mit-)Fühlen, Handeln.
Christen glauben an einen Gott, der für sie selbst zum barmherzigen Samariter geworden ist. In Jesus Christus hat Gott unsere Not gesehen, mit uns gefühlt und ist zum Retter geworden. Darum ist es unsere Aufgabe, zu sehen, zu fühlen und mit allen Menschen guten Willens zu helfen. Amen.
Predigt über 4. Mose 6, 22-27 (7.6.2020)
Und der HERR redete mit Mose und sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet: Der HERR segne dich und behüte dich; der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; der HERR erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne.
Liebe Gemeinde,
die Worte, die wir gerade als Predigttext gehört haben, gehören wie das Vaterunser und das Glaubensbekenntnis zu den vertrautesten und immer wiederkehrenden Teilen des Gottesdienstes. So hat einmal jemand gesagt: „Ohne Segen ist der Gottesdienst für mich kein Gottesdienst.“ Der Segen gehört zu dem Besten, das die Kirche den Menschen geben kann. Auch bei den Konfirmanden und möglicherweise bei dem einen oder anderen etwas älteren Gottesdienstbesucher ist der Segen sehr beliebt, ja er wird von manch einem geradezu ersehnt. Schließlich ist er ja das sichere Zeichen dafür, dass der Gottesdienst bald zu Ende ist. Dabei hat der Segen nicht nur am Ende des Gottesdienstes seinen Ort.
In besonderen Situationen unseres Lebens wird er uns zugesprochen: Bei der Taufe beispielsweise, bei der Konfirmation, oder wenn zwei Menschen miteinander die Ehe eingehen, also immer dann, wenn wir an entscheidenden Wegpunkten unseres Lebens stehen, wird uns der Segen Gottes zugesprochen. Oder wir selber wünschen einander den Segen Gottes, beispielsweise zum Beginn eines neuen Jahres, oder am Geburtstag, oder wenn wir vor einer besonders schwierigen Situation stehen, dann sagen wir Gemeindemenschen es einander zu: „Ich wünsche Dir den Segen Gottes!“ Oder gerade eben, beim Einzug in den Gottesdienst, wurde mir von einem Presbyter Gottes Segen gewünscht. „Ja, den brauch ich,“ habe ich in einer solchen Situation schon mal geantwortet, „aber ihr als Gemeinde auch.“
Das wird im Anfangsteil unseres Gottesdienstes ausgedrückt, wenn wir uns gegenseitig die Worte zusprechen: „Der Herr sei mit Euch!“ „Und mit deinem Geist!“ Das heißt doch: In der Gemeinde gibt es nicht Menschen, die den Segen austeilen und andere, die ihn empfangen. Gott ist es, der segnet. Und wir Menschen sind es, die ihn empfangen. Wir alle, ausnahmslos, brauchen den Segen Gottes wie die Luft zum Atmen. An Gottes Segen ist alles gelegen. Starke Worte.
Aber was meinen wir eigentlich, wenn wir vom Segen Gottes sprechen? Die Antwort kann der Predigttext geben, vor allem dann, wenn wir ihn nicht nur als gottesdienstliche Formel hören, sondern als Auftrag, den Gott seiner Gemeinde gegeben hat. „So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet:“
Mit diesem Auftrag Gottes wird der Segen eingeleitet. Gott selbst steht hinter dem Segen. Nur er und niemand sonst kann segnen.
Was aber heißt segnen? In unserer protestantischen Tradition sind wir es ja gewohnt, die Dinge des Glaubens zu spiritualisieren. Das heißt, wir erwarten die Erfüllung vieler Zusagen Gottes nicht schon in diesem Leben, sondern erst in Gottes Ewigkeit. Erst im Himmel wird wahrer Friede sein, werden die Unterschiede zwischen uns keine Bedeutung mehr haben, dann reichen sich alle Menschen die Hand in wahrer Brüderlichkeit. Dann wird uns nichts mehr voneinander trennen. Erst in Gottes Ewigkeit werden Krankheit, Leid und Tod ein Ende haben.
Diese Spiritualisierung des Glaubens hat gute Gründe. Das Kreuz, an dem Jesus starb, macht uns nur all zu deutlich, dass wir noch nicht im Himmel leben. Auf diesem Hintergrund wird es uns vielleicht überraschen, dass das Heil Gottes im AT unmittelbar verwoben ist mit Wohl des Menschen in der Gegenwart. Gott, wie er sich im At den Menschen zeigt, liegt das Wohl des Menschen im Hier und Jetzt am Herzen. Es ist ihm nicht gleichgültig, ob wir Menschen Schmerzen leiden, verzweifelt sind und einander Unheil zufügen. Wie eine Mutter über dem Leben ihres Kindes wacht, so wacht Gott über seine Menschenkinder. Genau das nennt die Bibel Segen. Durch seinen Segen will er in unserem Leben Gutes wirken. Er schenkt Wachstum und Gedeihen, Glück und erfülltes Leben, Gesundheit und Wohlbefinden. In seinem Segen wirkt er aktiv Gutes in unserem Leben.
Daneben steht das Behüten Gottes. Darum heißt der erste Segenssatz: „Der Herr segne dich und behüte dich.“ Behüten meint das Fernhalten all dessen, was unser Leben zerstören will: Sünde, Unglück, Unfriede, Krankheit und Tod. Weil Gott nicht nur das ewige Heil, sondern auch das Wohl des Menschen am Herzen liegt, darum segnet und behütet er unser Leben.
Merkwürdig, dass uns das oft gar nicht auffällt. Wir leben so, als hätten wir einen Anspruch darauf, dass alles in unserem Leben glatt laufen müsste. Um so mehr sind wir dann erstaunt oder von Gott enttäuscht, wenn das Unheil dann doch nach unserem Leben greift. Und genau das ist es, was die ganze Sache mit dem Segen für uns so schwierig macht. Manchmal, da macht es uns zu schaffen, dass wir das, was uns im Segen zugesprochen wurde, nicht mit der Wirklichkeit zusammenbekommen. Auch Menschen, die den Segen Gottes empfangen haben, müssen oft Schweres leiden.
Liebe Gemeinde, es tut mir leid, aber ich kann diesen Widerspruch nicht auflösen. Aber vielleicht kann uns ein zweiter Aspekt in unserem Segenstext einen Schritt weiterführen. Das zentrale Wort in den beiden folgenden Versen heißt „Angesicht“. Gott wendet uns sein Angesicht zu. Das heißt, Gott schenkt uns in seinem Segen nicht nur seine Gaben, sondern er schenkt sich uns selbst. Er schenkt uns seine Gegenwart und Nähe.
Als unsere Kinder noch klein waren, künnte es gelegentlich vorkommen, dass sie im Schlaf aufgeschreckt sind und geweint haben, weil sie sich allein gelassen fühlten. Erst als die Gesichter der Eltern in der Tür erschienen, wurde langsam alles wieder gut.
Gott schenkt uns durch den Segen sein Angesicht. Das heißt, er sieht durch die Tür unseres Lebens auf unsere Not. Durch Gottes Segen verändert sich nicht gleich die Welt. Aber er verändert uns. Er macht uns stark gegen das Zerstörerische in unserem Leben, wir wissen, Gott lässt uns nicht im Stich, was auch immer kommen mag. Seit Jesu Tod am Kreuz wissen wir: Gesegnet ist nicht nur der Sieger, nicht nur derjenige, der auf der Sonnenseite des Lebens steht, sondern gerade der Leidende kann mitten in der Niederlage gesegnet sein, weil er Gott bei sich weiß.
Lassen Sie mich Ihnen zum Schluss ein irisches Segenswort zusprechen, das genau diesen Gedanken ausdrückt:
Nicht, dass keine Wolke Deinen Weg überschatte, nicht, dass Dein Leben künftig ein Beet voller Rosen sei; nicht, dass Du niemals bereuen müsstest; nicht, dass Du niemals Schmerzen empfinden solltest – nein, das wünsche ich Dir nicht. Mein Wunsch für Dich lautet: Dass Du tapfer bist in Stunden der Prüfung; wenn andere Kreuze auf Deine Schultern legen; wenn Berge zu erklimmen und Klüfte zu überwinden sind; wenn die Hoffnung kaum mehr schimmert. Und noch etwas wünsche ich Dir: Dass Du in jeder Stunde der Freude und des Schmerzes die Nähe Gottes spürst – das ist mein Wunsch für Dich – heute und alle Tage. Amen.
Predigt über Joh 20,19-23 (01.06.2020)
19 Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch! 20 Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. 21 Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. 22 Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist! 23 Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen; und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten.
Liebe Gemeinde,
mit dem Predigttext, den wir gerade als Evangeliumslesung gehört haben, gehen wir noch einmal 50 Tage zurück und befinden uns am Abend des Ostersonntags. Trotz dieser Zeitangabe ähnelt vieles dem Pfingstbericht bei Lukas. Die Jünger sind wieder in einem Wohnhaus versammelt. Die Türen des Hauses sind von innen verschlossen, denn die Jünger fürchten sich. Sie haben Angst vor den Juden, ihren eigenen Volks- und Glaubensgenossen.
In beiden Texten ist dann vom Geschenk des Heiligen Geistes die Rede. Dass sie weiterführen, was Jesus angefangen hat, davon kann keine Rede sein. Weder wenden sie sich den Armen und Ausgestoßenen zu, noch verkündigen sie in den Straßen und Gassen Jerusalems die Auferstehung Jesu. Sie sind einfach nur verwirrt, verstört und voller Furcht. Lukas in der Apostelgeschichte und Johannes in seinem Evangelium, sie beschreiben beide den Start der Kirche. Und dieser Start könnte nicht desolater gewesen sein. Die Kirche ist am Tiefpunkt, weil die, die sie eigentlich tragen sollen, am Boden liegen. Tiefer können sie nicht fallen. Fast könnte man meinen, die Zeit der christlichen Kirche sei vorbei, ehe sie überhaupt begonnen hat. Der Glaube der Jünger ist eher am Ende als am Anfang. Böse gesagt: Kirche als Selbsterfahrungsgruppe von Angsthasen, das kann es nun wirklich nicht sein!
Liebe Gemeinde, haben wir heute nicht auch den Eindruck, dass die besten Zeiten der Kirche vorbei sind? Gerade im Osten Deutschlands ist nur noch eine Minderheit in der Kirche. Und auch hier im Westen verlieren die Kirchen Mitglieder, Gemeinden werden zusammengelegt, Gottesdienste finden vor fast leeren Bänken statt.
In der Abschlusspredigt zum Kirchentag vor einem Jahr in Dortmund erzählte Pfarrerin Sandra Bils von einem Gespräch mit Bekannten beim Bier. Da meinte jemand:
„Nimm es mir nicht übel, aber eure Zeit ist einfach vorbei.“ Und tatsächlich, viele Christen sehen ängstlich in die Zukunft. Die Situation am Anfang der Kirche und die Situation heute scheinen sich kaum zu unterscheiden. Mut- und kraftlos versammelt sich eine überschaubare Gruppe von Menschen im Namen Jesu. Sie trauern der Vergangenheit nach und haben keinen Plan für die Zukunft.
Doch dann wird in unserer Geschichte alles anders. Jesus tritt in ihre Mitte und beauftragt die Jünger: „Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch.“ Dazu rüstet er sie nicht mit Plänen und Strategien aus, sondern mit dem Heiligen Geist. Er bläst sie an und sagt: „Nehmt hin den Heiligen Geist!“
Noch einmal Sandra Bils in Ihrer Kirchentagspredigt:
„Wir gehören zu Jesus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, der sich mit Prostituierten, Steuerbetrügern und Aussätzigen umgab. Wir sind Gottes geliebte Gurkentruppe!“
Das heißt: Jesus hat viel Erfahrung mit Menschen, die in irgendeiner Weise einen Mangel haben. Und genau das ist das Besondere an Jesus, dass er mit diesen Unvollkommenen, Gescheiterten und Anrüchigen seine Kirche bauen will. Wir sind Gottes Gurkentruppe, und Gott weiß das auch.
Gurkentruppe: Beim Fußball meint das eine Mannschaft, die nichts zustande kriegt. Gurkentruppe gleich Versager. Die Kirche ist eine solche Gurkentruppe, ein Haufen Menschen, die mehr versagen als dass sie Großes tun. Aber dieser Haufen ist von Gott geliebt. Das macht den Unterschied. Als geliebte Gurkentruppe wachsen wir über uns hinaus, schaffen wir Dinge, die wir uns gar nicht zugetraut hätten. Das aber ist möglich durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist die unsichtbare Gegenwart Jesu in seiner Kirche. Das ist die Botschaft von Pfingsten: Wir sind nicht allein gelassen. Jesus ist bei uns. Er wirkt in unserer Mitte. Er öffnet die Türen, hinter die wir uns verschanzen. Er sendet uns zu Menschen, zu denen sonst niemand geht. Er macht uns zu Friedensstiftern und zu Boten seiner Liebe. Darum werden die Jünger, die sich jetzt noch ängstlich und verzweifelt in einem Wohnhaus verstecken, wenige Jahrzehnte später das Evangelium bis an die Enden der damals bekannten Welt getragen haben. Sie werden etwas in die Welt bringen, das die Welt so noch nicht gekannt hat: die Liebe eines gekreuzigten Gottes. Sie werden diese Liebe glaubwürdig machen, indem sie die Armen speisen, Gefangene versorgen, Kranke besuchen und denen eine Stimme verleihen, die nicht für sich selbst sprechen können.
Liebe Gemeinde, das ist auch unsere Berufung. „Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch.“ Wir sind dazu berufen, eine pfingstliche Kirche zu sein, die nicht auf ihre Unzulänglichkeiten sieht, sondern mit den Möglichkeiten Gotte rechnet. Auch für uns gilt: Wir sind nicht allein gelassen. Jesus ist bei uns. Er wirkt in unserer Mitte. Er öffnet die Türen, hinter die wir uns verschanzen. Er sendet uns zu Menschen, zu denen sonst niemand geht. Er macht uns zu Friedensstiftern und zu Boten seiner Liebe.
Ob unsere Zeit vorbei ist? Die Zahlen scheinen dafür zu sprechen. Und doch: Wir werden gebraucht, um Nächstenliebe zu leben. Wir werden gebraucht um den Gott der Liebe zu den Menschen zu bringen. Und wir werden gebraucht, um unserer Zeit auch unbequeme Wahrheiten zu sagen.
Dazu drei Sätze, die nicht ohne Widerspruch bleiben: Im Blick auf rechte Umtriebe in unserer Stadt sage ich: „Rassismus ist Gotteslästerung.“
Im Blick auf ertrunkene Flüchtlinge im Mittelmeer sagt Sandra Bils: „Menschen lässt man nicht absaufen. Punkt.“
Im Blick auf Auslandseinsätze deutscher Soldaten hat Margot Kässmann vor Jahren einmal gesagt: „Nichts ist gut in Afghanistan.“
Das können wir nicht aus uns heraus. Darum bitten wir um die Kraft des Heiligen Geistes: „Du Heilger Geist, bereite ein Pfingstfest nah und fern; mit deiner Kraft begleite das Zeugnis von dem Herrn. O öffne du die Herzen der Welt und uns den Mund, dass wir in Freud und Schmerzen das Heil ihr machen kund.“ Amen.
Predigt Apg 2,1-21 Pfingstsonntag (31.05.2020)
Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. 2 Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. 3 Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt, wie von Feuer; und er setzte sich auf einen jeden von ihnen, 4 und sie wurden alle erfüllt von dem heiligen Geist und fingen an, zu predigen in andern Sprachen,* wie der Geist ihnen gab auszusprechen. 5 Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. 6 Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt; denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. 7 Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? 8 Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? 9 Parther und Meder und Elamiter und die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadozien, Pontus und der Provinz Asien, 10 Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom, 11 Juden und Judengenossen, Kreter und Araber: wir hören sie in unsern Sprachen von den großen Taten Gottes reden. 12 Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem andern: Was will das werden? 13 Andere aber hatten ihren Spott und sprachen: Sie sind voll von süßem Wein. 14 Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen: Ihr Juden, liebe Männer und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan, und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen! 15 Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, ist es doch erst die dritte Stunde am Tage; 16 sondern das ist's, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist (Joel 3,1-5): "17 Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch; und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen, und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen, und eure Alten sollen Träume haben; 18 und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie sollen weissagen. 19 Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf; 20 die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe der große Tag der Offenbarung des Herrn kommt. 21 Und es soll geschehen: wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden.
Liebe Gemeinde,
obwohl es nun wirklich schon lange her ist, erinnere ich mich noch sehr gut daran, wie es war, als ich den Pfingstbericht aus der Apostelgeschichte zum ersten Mal gehört hatte. Unsere Klassenlehrerin in der Grundschule hatte uns diese Geschichte in der Woche vor Pfingsten erzählt. Am Pfingstsonntag begleitete ich dann meine Großeltern zum Gottesdienst. Meine Erwartungen waren riesig groß. Ich stellte mir nämlich vor, dass sich das Pfingstereignis in jedem Jahr wiederholen würde. "Pfingsten schenkt uns Gott seinen Heiligen Geist.“, hatte die Lehrerin gesagt. Deshalb erwartete ich, dass Gottes Geist wie in der Bibel beschrieben mit Feuerflammen auf die versammelte Gemeinde herab kommen würde und wunderliche Dinge passieren würden. Doch nichts von alledem geschah. Der Gottesdienst lief ab wie immer, vom Heiligen Geist war nichts zu sehen. Enttäuscht ging ich wieder nach Hause. Im nächsten Jahr blieb ich Pfingsten Zuhause.
Liebe Gemeinde, auch bei uns wird heute, am Pfingstsonntag, nichts Spektakuläres geschehen. Da werden (vermutlich) keine Feuerflammen vom Himmel fallen. Da wird kein Brausen, wie von einem gewaltigen Sturm, unsere Kirche erfüllen. Und Sie werden vermutlich auch nicht vor Ablauf des Gottesdienstes auf die Straße laufen, um das Evangelium in Türkisch, Arabisch, Farsi oder irgendeiner anderen Sprache zu verkündigen. Rein äußerlich ist alles wie immer. Unspektakulär eben. Aber geht es in der Pfingstgeschichte überhaupt um diese spektakulären Ereignisse?
Vordergründig könnte man vielleicht den Eindruck gewinnen, es ginge hier um Feuer und Wind und wundersame Vielsprachigkeit. Doch diese vordergründigen Dinge wollen doch nichts anderes sein, als Hinweise auf das Eigentliche, das Pfingsten ausmacht. Versuchen wir also, den Pfingstbericht genauer zu lesen! Worauf weisen Feuer, Wind und Vielsprachigkeit hin? Die äußeren Zeichen weisen auf ein inneres Geschehen hin. Im Denken, Fühlen und Handeln der Jünger wird etwas anders. Bis zum eigentlichen Pfingstgeschehen hatte gegolten: Es gibt ein klares „Wir hier drinnen“ und „Die da draußen“.
Doch jetzt gehen die Türen auf. Die Jünger sind zu Menschen gesandt, die sie vorher gar nicht wahrgenommen haben. Genau das aber bedeutet Pfingsten: Menschen kommen in den Blick, die vorher nicht im Blick waren. In Jerusalem waren das nicht nur Juden, sondern auch die sogenannten „Gottesfürchtigen“. Das waren Menschen, die anderen Völkern angehörten, ohne zum Judentum übergetreten zu sein. Sie glaubten an den Gott Israels, gehörten aber offiziell nicht dazu. Die lange Aufzählung fremder Völker im Pfingstbericht hat schon so manchen Lektor zur Verzweiflung gebracht:
„Parther und Meder und Elamiter und die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadozien, Pontus und der Provinz Asien, 10 Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom, 11 Juden und Judengenossen, Kreter und Araber.“
In der Vergangenheit bin ich schon gefragt worden, ob man diese lange Aufzählung nicht einfach weglassen kann. Aber genau darum geht es in dem Text: Menschen kommen in den Blick, die bislang nicht im Blick waren. Nehmen wir nur einmal zwei Begriffe heraus: Phrygien und Pamphylien. Das sind zwei Gegenden in der heutigen Türkei. Phrygien meint einen Teil Anatoliens und Pamphylien ist die Gegend um das heutige Antalya. Und auch Kappadokien und die Provinz Asien meinen Gegenden in der Türkei.
Gerade aus diesen Regionen sind Menschen zu uns nach Deutschland gekommen. Erst als sogenannte Gastarbeiter und jetzt als Flüchtlinge vor einem autoritären System. Jahrzehntelang haben wir uns in Deutschland so verhalten wie die Jünger vor dem Pfingstereignis: Es gab ein Drinnen und Draußen, und die Draußen haben wir gar nicht wahrgenommen. Pfingsten aber heißt: Menschen kommen in den Blick, die bislang nicht im Blick waren. Und mehr noch: Verstehen wird möglich. Echtes Verstehen. Die Menschen in Jerusalem hören nicht nur Worte in ihrer Muttersprache, sondern sie verstehen auch den Sinn der Botschaft. Sie fühlen sich verstanden.
Es war zu Beginn der sogenannten Flüchtlingskrise, da hörte ich bei einem Konfirmandenausflug im Bus das Gespräch zweier Konfirmanden mit. Da erzählte ein Konfi, dass es jetzt in fast jeder Klasse mindestens einen Flüchtling gibt. Auch in seiner Klasse. Da ist ein Junge, der ganz allein nach Deutschland gekommen ist, weil seine Eltern im Krieg umgekommen sind. „Stellt dir nur vor, wie das ist, sagte der Konfi, „wenn der mit einer guten Zensur nach Hause kommt, dann ist da niemand, der sich darüber freut. Oder neulich bei der Klassenfahrt: Da sind alle Schüler von den Eltern zum Bus gebracht worden. Nur der, der kam ganz alleine!“ Ich muss sagen, ich war stolz auf die beiden Konfirmanden, dass sie sich so in die Situation eines Flüchtlings hineinversetzen konnten. „Stell Dir vor, wie das ist…!“
Sich in die Situation eines Menschen versetzen zu können, der doch anders ist als man selbst, so beginnt echtes Verstehen. Echtes Verstehen aber ist Ausdruck von Nächstenliebe. Sie ist nicht beschränkt auf den, der so ist wie ich selber. Nächstenliebe kennt keine Grenzen, weil Gottes Liebe auch keine Grenzen kennt.
Beim Begegnungscafé in unserer Gemeinde geht es ebenfalls um ein gegenseitiges Verstehen. Da kann jeder seine Geschichte erzählen und die anderen hören zu und versuchen, sich in die Lage des anderen hinein zu versetzen. Das ist nichts anderes als Nächstenliebe. Da ereignet sich Pfingsten.
Auf der neuen Homepage unserer Gemeinde habe ich unter das Foto der Matthäuskirche folgenden Text geschrieben:
„Wenn Sie genau hinsehen, werden Sie feststellen, dass die Türen der Matthäuskirche auf dem Foto weit geöffnet sind. Das soll heißen: Jeder ist willkommen! Ganz gleich, welche Vorgeschichte einen Menschen geprägt hat, woher er kommt, welche Sprache er spricht, wie seine sexuelle Orientierung ist, niemand ist ausgeschlossen. Gott hat eine Geschichte mit jedem Menschen. Jeder Mensch ist von Gott geliebt. Jesus lädt alle Menschen zu sich ein mit den Worten: "Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken!" (Mt. 11,28)
Wenn wir diese Offenheit hier in Baukau miteinander leben, dann ist Pfingsten geworden. Das ist nicht spektakulär, aber ein kleines Stück weltverändernd. Amen.